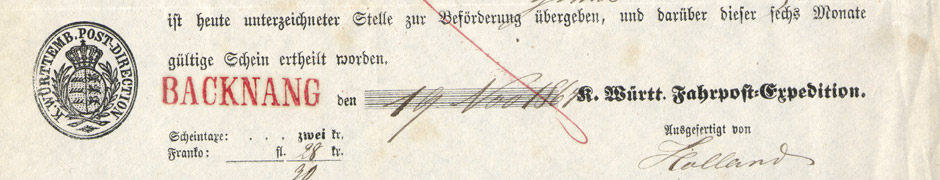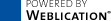Spezialsammlungen
Hier werden zum einen Teilgebiete der klassischen Sammlungen mit hohem Spezialisierungsgrad behandelt oder zum anderen Themen, die dort nicht vorkommen. Aufgrund der Vielfalt bei den Spezialsammlungen kann nur eine Auswahl gezeigt werden.
Heimatsammlung - Heimatphilatelie
Eine Heimatsammlung
verknüpft philatelistische Aspekte mit der Geschichte eines oder mehrerer Orte,
einer Stadt oder einer Region. Gesammelt werden nicht nur Marken und Briefe
sowie postinterne Dokumente (Postscheine, Instruktionen), sondern auch
nichtpostalische Dokumente aus Handel und Gewerbe, Verwaltung (Stichworte
Bürgerrechte, Armenwesen, Militär) und Umwelt (Forstwesen, Straßenbau,
Gewässer). Prinzipiell kann alles aufgenommen werden, was die Vergangenheit des
jeweiligen Ortes beleuchtet.
Im Vordergrund steht
gewöhnlich die örtliche Postgeschichte von ihren Anfängen (die ersten
Posthalter, Postämter) bis in die heutige Zeit. Die lokalen Stempel und
Postformulare sind vorzustellen, die Ausdehnung des Postbezirks und die Postwege
etwa in den Landbestellbezirk oder zu den Nachbarpostämtern werden untersucht
und kartiert. Alte Stiche oder Fotos von Postämtern und Postbeamten sind
willkommene Ergänzungen der Sammlung.
Ein fortgeschrittener
Heimatsammler wird auch die örtlichen Archive (falls vorhanden) oder
überregionale Archive aufsuchen. Dort kann er seine Kenntnis von der Geschichte
seines Ortes, die im übrigen nicht isoliert von der württembergischen und
deutschen Geschichte erforscht werden kann, vertiefen und dabei vielfältige
Anregungen für den Ausbau seiner Heimatsammlung finden.
Die altdeutschen Schreibschriften wird er nach und nach zu lesen lernen. Auch ein Grundstock an orts- oder regionalgeschichtlicher Literatur und das eine oder andere ältere Konversationslexikon ist für ihn bald unentbehrlich.
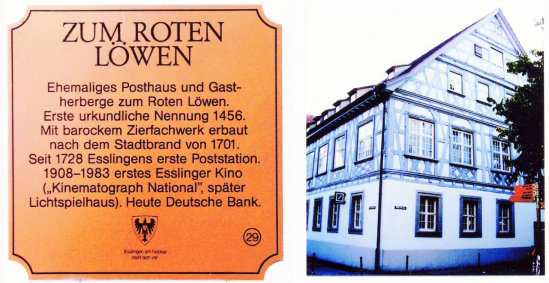
Ansprechpartner: Gerhard Kümmel.
Stempel
Kaum ein anderer
altdeutscher Staat bietet eine solche Vielfalt an schönen und teilweise
seltenen Stempeln wie Württemberg!
Zu Beginn der Markenzeit Ende 1851 wurden zunächst die Stempel der Vorphilazeit
weiter benutzt (vor allem Zweizeiler, Kreisstempel, Steigbügelstempel). Aber
schon bald gab es Versuche mit neuen Stempelformen, etwa mit den nur wenige
Wochen verwandten und daher heute extrem seltenen Stummen Stempel. Der Grund für
die Experimentierfreude war, dass viele Stempel aus der Vorphilazeit sich
aufgrund ihrer Abmessungen nicht sonderlich für die von der Postverwaltung
vorgeschriebene zentrische Entwertung der Briefmarken eigneten.
Im April 1852 wurde eine neue Stempelform, der Dreikreisstempel (Dkr),
eingeführt, die sich vorzüglich zur vorgeschriebenen Entwertung der Marken
eignete, da sowohl der Ortsname als auch das Datum auf der Marke zu lesen
waren. Der sehr attraktive Dkr, mit dem in über 200 Orten gestempelt wurde, ist
der württembergische Kreuzer-Stempel schlechthin. Erst gegen Ende der 1860er
Jahre wurde er nach und nach von den eher unscheinbaren Einkreisstempeln
abgelöst. Diese kamen in den neu eingerichteten Postagenturen und Ämtern von
vornherein zum Einsatz. Viele ältere vor
allem kleinere Postorte haben die unverwüstlichen DKr weiter benutzt, häufig sogar noch nach 1900. Solche spät- oder nachverwendeten DKr sind bei Spezialisten sehr gefragt.
Bis in die zweite Jahreshälfte 1853 wurden alle Stempel in blauer Farbe
abgeschlagen, erst danach in Schwarz. Viele blauen Stempelabschläge aus
kleineren Orten zumal auf Brief sind wegen der kurzen Verwendungszeit heute
extrem selten und von Sammlern sehr gesucht.
Einen detaillierten Einblick in das interessante Sammelgebiet bietet das Handbuch „Stempel der Kreuzerzeit 1851-1875“ von Thomas Heinrich, das von der ArGe-Württemberg 2016 in der 2. Auflage herausgegeben wurde.

Literatur: Stempel der Kreuzerzeit 1851-1875 (2. Auflage) und
Postalische Stempel Württembergs 1875-1925.
Ansprechpartner:
Gabriel Böck, Thomas Heinrich, Marc Klinkhammer, Hartmut Winkler
Plattenfehler

Plattenfehler (PF) auf
Marken entstehen durch Beschädigungen der Druckform. Die Ursache liegt entweder
im Urstöckel, in der Matrize, im Druckgalvano oder in der Druckplatte. PF
können bereits bei Druckbeginn vorhanden sein oder während des Druckvorganges
durch Beschädigung oder Abnutzung der Druckplatte entstehen. Sie sind zu
unterscheiden von Druckzufälligkeiten, die durch Fremdkörper auf den Druckplatten
hervorgerufen werden.
Besonders häufige PF gibt es auf der 1. Ausgabe (Ziffernausgabe), etwa auf der Mi.Nr. 2 (fast 30), und auf den letzte beiden Wappenausgaben (19 auf der Mi.Nr. 26, 29 auf Mi.Nr. 31). Der Michel-Spezialkatalog kann nur die auffälligsten PF verzeichnen. Gelegentlich werden auch heute noch neue PF entdeckt.
Literatur: Handbuch der Plattenfehler 1851 - 1925
Ansprechpartner: Thomas Heinrich, Hartmut Winkler
Ganzsachen
Ganzsachen (GA) sind von der Post
verausgabte Briefumschläge, Postkarten, Streifbänder, Paketkarten etc. mit
einem Wertstempeleindruck in Höhe des normalerweise erforderlichen Portos; sie
sind amtliche Postwertzeichen. Von allen altdeutschen Staaten besitzt
Württemberg die größte Vielfalt an GA seit der Kreuzerzeit. Neben GA für den
privaten Postverkehr wurden auch Dienstganzsachen des Bezirksverkehrs
(Gemeindebehörden) und der Staatsbehörden verausgabt. Privatpersonen hatten die
Möglichkeiten, Privatganzsachen bei der Post zu bestellen.
Die württembergischen GA sind gut erfasst und katalogisiert, so dass man bequem
in das Sammelgebiet einsteigen kann. Alles, was das Sammeln von Markenbelegen
reizvoll macht (Frankaturen, Destinationen, Stempel etc.), gilt auch für die
GA. Neben solchen, die bestimmungsgemäß verwandt wurden, gibt es viele GA mit
Zusatzfrankaturen (etwa nach einer Portoerhöhung oder bei
Gewichtsüberschreitung). Solche Belege können eine Sammlung stark aufwerten.
Das Sammeln von GA ist spannend und interessant und dabei durchaus erschwinglich, sieht manvon einigen seltenen Stücken ab.

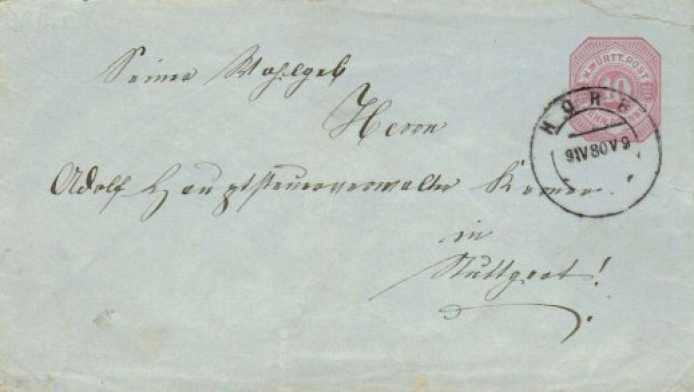
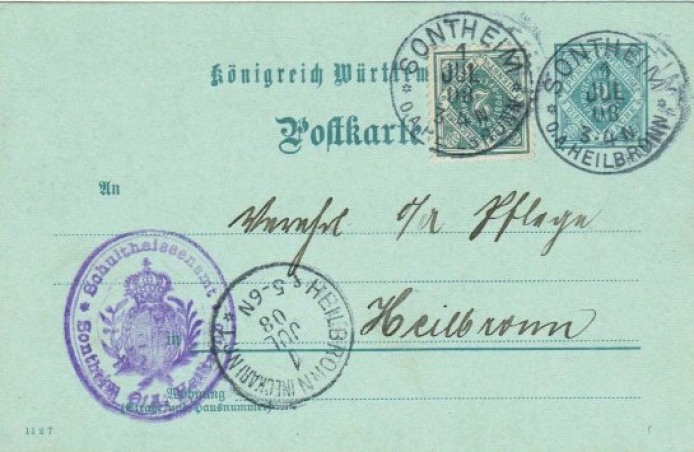
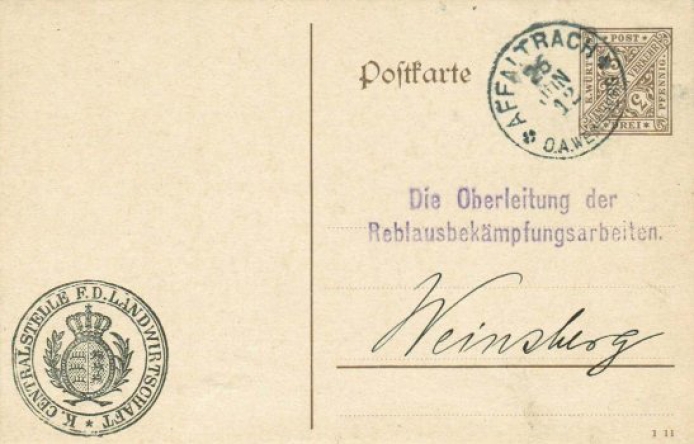
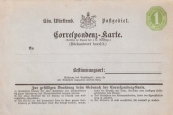
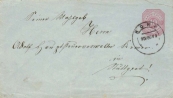


Literatur: Michel Individual-Katalog der ArGe-Württemberg
e. V. und Rundbriefe der ArGe-Württemberg e. V.
Ansprechpartner:
Gabriel Böck, Hartmut Winkler
Telegraphenmarken
In Württemberg wurden
als drittem altdeutschen Staat nach Preußen und Bayern 1875 Telegraphenmarken
eingeführt. Spätere Ausgaben kamen 1878 (Farbänderungen) sowie 1880 hinzu
(Änderung des Durchstichformats).
Mit den Telegraphenmarken wurde das Telegrammporto auf den entsprechenden
Formularen verklebt. Teile von Telegrammen oder gar vollständige mit Marken
frankierte Telegramme sind bisher nicht bekannt, da die Post die Formulare zu
vernichten hatte.
Die württembergischen Telegraphenmarken haben fast immer kleine Durchstichmängel oder dünne Stellen (sie wurden in der Regel von den Formularen heruntergerissen) und sind ein schwieriges Teilgebiet der Württemberg-Philatelie.

Literatur: Michel Individual-Katalog der ArGe-Württemberg
e. V.
Ansprechpartner: Marc Klinkhammer, Hartmut Winkler
Feldpost 1871
Im deutsch-französischen Krieg der Jahre 1870/71 kamen auch Soldaten des Königreichs Württemberg zum Einsatz. Ihre gewöhnliche Korrespondenz (auch die an die Soldaten gerichteten Schreiben) war wie generell üblich vom Porto befreit. Die württembergische Post gab spezielle Korrespondenzkarten und Umschläge für die Feldpost heraus, die im Feld mit besonderen Feldpoststempeln entwertet wurden. Gesammelt werden also vollständige Karten und Umschläge mit oder ohne Inhalt.

Literatur: Rundbriefe
der ArGe-Württemberg e. V.
Ansprechpartner: Thomas Heinrich, Klaus Irtenkauf
Feldpost 1914/18
Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wurden auch Feldpostämter und Feldpostexpeditionen in Württemberg mobilisiert, um die Post der württembergischen Truppen im Felde zu bearbeiten. Die Ämter waren mit eigenen Aufgabestempeln ausgestattet, in denen die Truppenbezeichnung angegeben war. Für die Soldaten war die Feldpost portofrei, sofern die vorgeschriebenen Gewichtsgrenzen nicht überschritten und keine Zusatzleistungen abverlangt wurden. Zu Anfang 1917 entfernte (aptierte) man aus Geheimhaltungsgründen alle Truppenangaben in den Aufgabestempeln. Danach wurden die württembergischen Aufgabestempel durch numerierte Feldpoststempel in Einheitsform des Deutschen Reiches ersetzt.

Literatur: Rundbriefe
der ArGe-Württemberg e. V.
Ansprechpartner: Hartmut Winkler, Marc Klinkhammer
Amtlich eröffnet (Retourbriefe)
Ein Brief, der dem
Adressaten nicht zugestellt werden konnte (z. B. unbekannt, abgereist oder
verstorben), lief zurück ans Ausgangspostamt. Wenn kein Absender angegeben war,
Siegel oder Handschrift nicht sicher zugeordnet werden konnten, so wurde der
Brief bei der zuständigen Stelle beim Ober- oder Hauptpostamt „amtlich eröffnet"
(geöffnet), um den Absender zu ermitteln. Dessen Anschrift vermerkte der Postbeamte
in roter Tinte auf der Briefrückseite. Dann wurde der Brief wieder
verschlossen, wobei in älterer Zeit spezielle Siegel verwandt wurden, ehe im
Juni 1852 die württembergische Post spezielle Verschlussmarken einführte. Diese
wurden aufgeklebt, aber nicht gestempelt.
Aussehen, Farbe und Inschrift dieser Retourmarken haben sich mehrfach geändert, zuletzt 1918. Komplett erhaltene Retourbriefe mit unbeschädigter Verschlussmarke sind häufig auch ästhetisch eindrucksvoll.




Literatur: Rundbriefe
der ArGe-Württemberg e. V.
Ansprechpartner: Klaus
Irtenkauf, Hartmut Winkler
Portofreiheit
Schon lange vor der
Einführung der ersten Briefmarken gab es viele Persönlichkeiten, Ämter und
Institutionen, die vom Porto befreit waren. Neben den staatlichen und
kirchlichen Einrichtungen kamen vor allem die Mitglieder des Königshauses in
den Genuss der Portofreiheit. Auf den Poststücken mußte durch entsprechende
Hinweise, Siegel oder Stempel der Anspruch auf Portofreiheit kenntlich gemacht
werden.
Gesammelt werden ganze Briefe mit oder ohne Inhalt. Speziell die Briefe des Königshauses tragen oft dekorative Siegel oder Absenderstempel.

Literatur: Rundbriefe
der ArGe-Württemberg e. V.
Ansprechpartner:
Hartmut Winkler
Formulare
Formulare sind
vorgedruckte Schriftstücke des Verwaltungswesens. Zu den Postformularen
(Vordrucken) zählen nicht nur die häufigen Einlieferungsscheine und
Paketkarten, sondern auch seltenere Formulare wie Rückscheine, Postaufträge
(Postmandate) sowie schließlich die außerordentlich seltenen Beschädigungsmitteilungen,
Sendungsnachfragen (Laufzettel), Unbestellbarkeitsmeldungen,
Benachrichtigungsscheine, Formulare des Fernsprechdienstes,
Doppeleinlieferungsscheine und anderes mehr.
Für das Ausstellen von besonderen Formularen (etwa eines Laufzettels) wurde eine Gebühr berechnet, die auf dem Formular zu frankieren war. Manche Postformulare sind extrem selten und werden entsprechend hoch gehandelt.

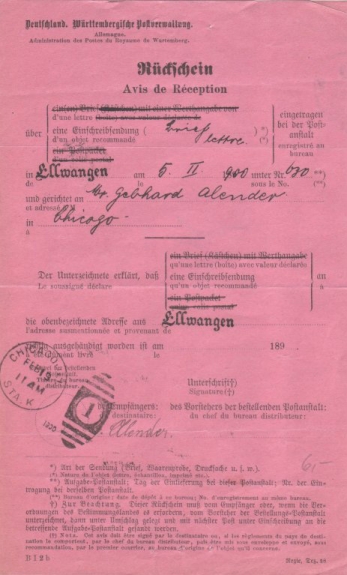
Literatur: Rundbriefe
der ArGe-Württemberg e. V.
Ansprechpartner: Klaus
Irtenkauf, Axel Schramek, Hartmut Winkler
Postscheine
Postscheine sind vorgedruckte amtliche Formulare, auf denen der Postbeamte mit seiner Unterschrift die Einlieferung eines eingeschriebenen Briefes, eines Wertbriefes oder eines Pakets dem Aufgeber bescheinigte, damit dieser im Falle eines Verlustes Ersatzansprüche geltend machen konnte. Solche Postscheine hat die württembergische Post auch schon in vorköniglicher Zeit drucken lassen. Wer Postscheine sammelt, muss also bis ins 18. Jh. zurückgehen, als einzelne Scheine noch handschriftlich ausgefüllt wurden. Auch die in Württemberg tätige Kaiserliche Reichspost, die vom Haus Thurn-und-Taxis betrieben wurde, verwandte eigene Scheine.
Da der Druck häufig örtlicher Initiative unterlag, können die Scheine ganz unterschiedlich aussehen. Selbst an ein und demselben Ort unterscheiden sich die Postscheine im Laufe der Jahre durch das Format, das Papier und vor allem durch einen mehr oder weniger aufwendigen Druck (mit oder ohne Ortseindruck, Portoangaben, Wappen, Zierrahmen, Illustrationen). Gesammelt werden auch unterschiedliche Auflagen mit kleineren oder größeren Abweichungen oder Druckfehlern.
In der frühen Kreuzerzeit wurden die alten Postscheine nach und nach durch standardisierte Einlieferungsscheine (Regiescheine) abgelöst, für die sich vor allem Heimatsammler interessieren. Postscheine sind ein breites, aber auch erschwingliches Sammelgebiet, in dem es immer wieder Neues zu entdecken gilt.
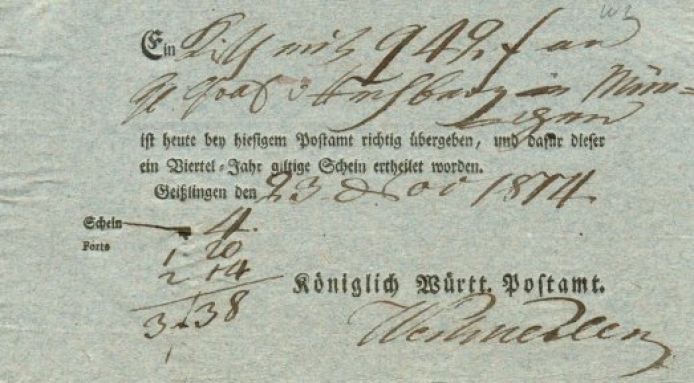
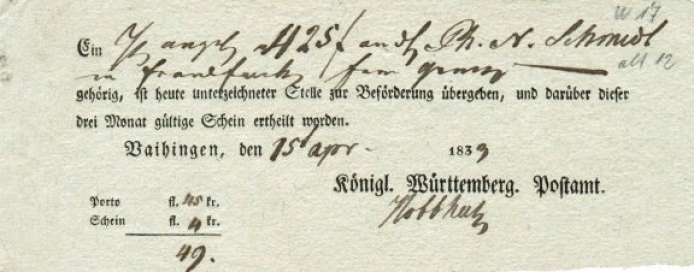
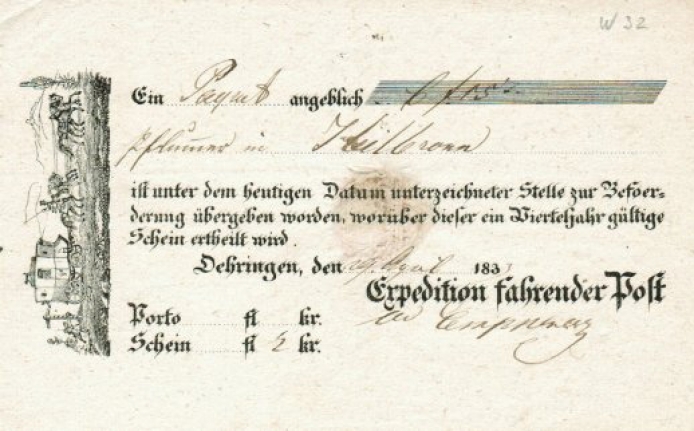
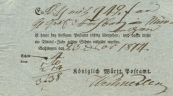
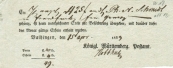
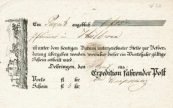
Literatur: Rundbriefe
der ArGe-Württemberg e. V.
Ansprechpartner: Axel
Schramek, Klaus Irtenkauf
Bahnpost
Die ersten württembergischen Bahnlinien wurden Ende der 1840er Jahre eröffnet. Wegen des Widerstands des Hauses Thurn-und-Taxis, das bis Ende März 1851 in Württemberg mit der Post belehnt war, konnten erst am 1. April 1852 die ersten „fahrenden Postämter“ eingerichtet werden. Die Postbeamten in den Bahnpostwagen führten eigene Stempel, die neben dem Datum auch die Zugnummer und bald auch eine Beamtennummer vermerkten.
Von diesen
Bahnpoststempeln, die in zahlreichen Varianten auftreten, streng zu
unterscheiden sind die Bahnstempel (Segmentstempel), die Stempel der
Bahnverwaltung sind. Mit den Bahnstempeln wurden etwa die Frachtbriefe
abgestempelt (siehe dort). Gelegentlich kommen sie aber auch auf Poststücken
als Neben- oder Entwertungsstempel vor (etwa wenn in kleineren Bahnhöfen gar
keine Poststelle eingerichtet war) und sind in dieser Form sehr gesucht. Aus
diesem Grund sind alle bahnamtlichen Segmentstempel auch in den Stempel-
handbüchern unserer Arge mit erfasst, obwohl dort eigentlich nur Poststempel aufgeführt sind.
Als die
Württembergische Staatsbahn im Jahr 1920 in die Reichsbahn eingegliedert wurde,
verloren auch die dortigen Bahnposten ihre Selbständigkeit.
Die Vielzahl verschiedener Typen von Bahnpost- und Bahnstempeln, mit deren Hilfe man etwa die Bahnkurse bestimmen kann, macht dieses spezielle Sammelgebiet besonders interessant.
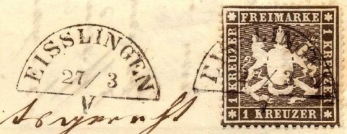
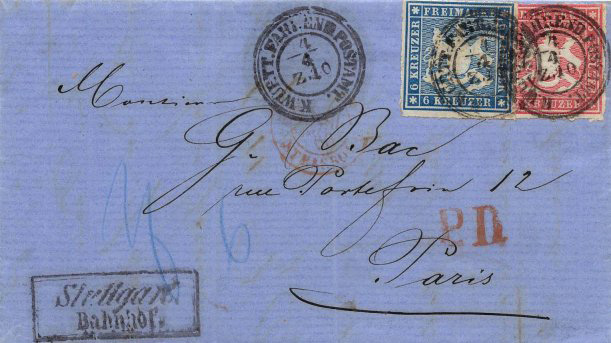
Literatur: Stempel der Kreuzerzeit 1851-1875, Postalische
Stempel Württembergs 1875-1925 und Rundbriefe der ArGe-Württemberg e. V.
Ansprechpartner:
Marc Klinkhammer
Frachtbriefe
Analog zur Post waren auch bei der Bahn unterschiedliche Formulare für die diversen Aufgaben in Gebrauch. Zu diesen bahnamtlichen Formularen gehören auch Frachtbriefe. Nicht nur Heimatsammler nehmen Frachtbriefe gerne in ihre Sammlung auf, auch Sammler, die sich generell für das Eisenbahnwesen interessieren, können mit Frachtbriefen Streckenfahrten und Bahnlinien dokumentieren.
Frachtbriefe sind Begleitpapiere, die der Bahnfracht beigefügt waren. Sie vermerken Art und Gewicht der Ware, den Absender, den Empfangsbahnhof nebst der Adresse des Empfängers und die Gebührenverrechnung. Besonders attraktive Frachtbriefe entstehen, wenn die Gebühren mittels Eisenbahngebührenmarken beglichen wurden und diverse Bahnstempel – etwa auch Durchgangsstempel – abgeschlagen sind.
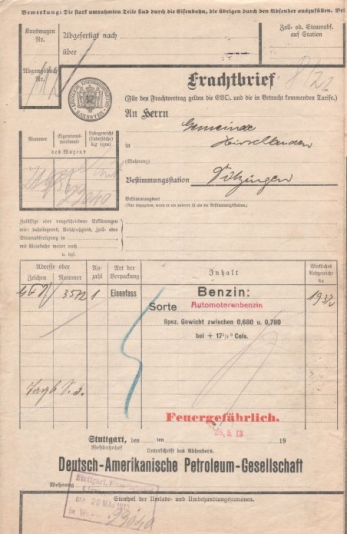
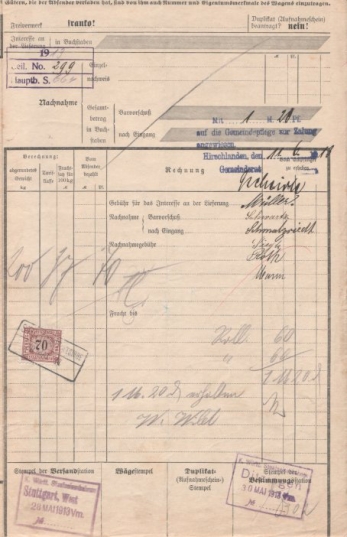
Literatur: Stempel der Kreuzerzeit 1851-1875
und Postalische Stempel Württembergs 1875-1925.
Ansprechpartner:
Marc Klinkhammer
Literatur
Zur
Württemberg-Philatelie gibt es vielfältige Literatur, angefangen bei J.-B.
Moens „Les timbres du Wurtemberg“ von 1881, bis zu den neuesten Handbüchern
„Postalische Stempel Württembergs 1875 – 1925“ von H. Winkler/M. Klinkhammer
(2012), T. Heinrich, Briefpost im Königreich Württemberg 1851-1875 (2014).
Dazwischen liegen neben vielen weiteren Veröffentlichungen, insbesondere auch
in philatelistischen Periodika, Lindenbergs „Die Briefumschläge von
Württemberg“ von 1895, von K. Köhler „Die Briefmarken von Württemberg 1851 –
1881“ aus 1940, Wölffing-Seeligs „500 Jahre Post in Württemberg“ von 1965, das
„Handbuch der Württemberg-Philatelie/Kreuzerzeit“ von Brühl/Thoma, „Die
Postscheine der Kreuzerzeit“ von Dr. Seeger, „Die private Stadtpost Stuttgart“
von H. Jaedicke, „Stempel der Kreuzerzeit 1851 – 1875“ von T. Heinrich.
Besonders hinzuweisen ist auf die Rundbriefe der Arbeitsgemeinschaft Württemberg mit vielfältigsten Informationen insbesondere aus den letzten 40 Jahren.

Kontakt
Arbeitsgemeinschaft Württemberg e.V.
c/o Marc Klinkhammer
Hirschstraße 12
71254 Ditzingen